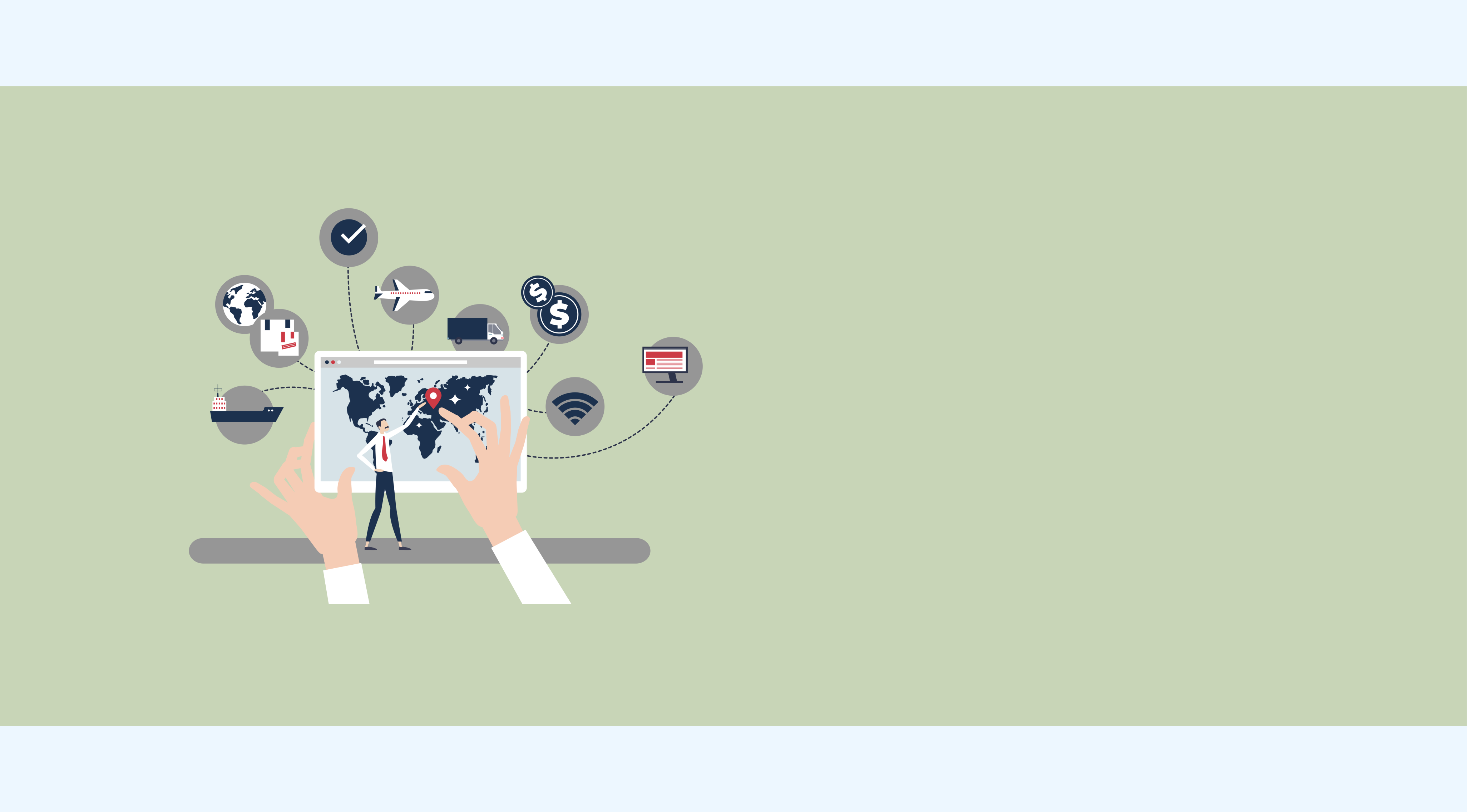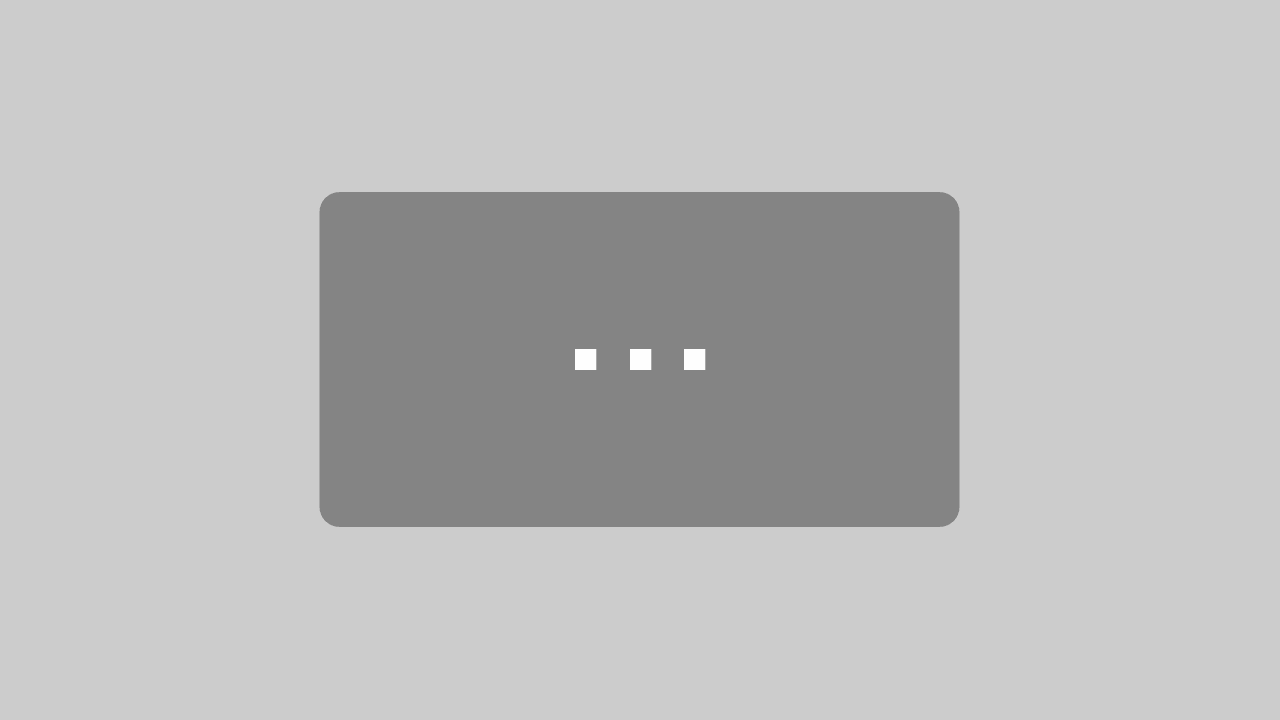Neue Lieferkettengesetze schaffen einen rechtlichen Rahmen zum Schutz der Menschenrechte und Umwelt entlang globaler Lieferketten. Sie legen fest, ab welcher Unternehmensgröße und in welchem Umfang Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten nachkommen müssen.
Wie kann WifOR Unternehmen im Umgang mit dem deutschen Lieferkettengesetz unterstützen? Mehr dazu hier.
Was regelt das deutsche Lieferkettengesetz?
Seit Januar 2023 gilt das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden und Sitz oder Betriebsstätte in Deutschland. Ab 2024 liegt die Grenze bei 1.000 Beschäftigten.
Das LkSG verpflichtet Unternehmen dazu:
- menschenrechtliche Risiken in ihrer Lieferkette zu analysieren
- Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen
- Beschwerdemöglichkeiten einzurichten
- über diese Aktivitäten zu berichten
- und sich bei Nichteinhaltung vor deutschen Gerichten zu verantworten.
Ziele des deutschen Lieferkettengesetzes im Detail
Das Hauptziel des LkSG besteht darin, dass Unternehmen die Einhaltung grundlegender Menschenrechte und Umweltstandards entlang ihrer gesamten Lieferkette sicherstellen. Dies umfasst beispielsweise die Verhinderung gefährlicher Abfälle, Kinderarbeit oder Ausbeutung in Form moderner Sklaverei.
Schaffung von Rechtssicherheit
Das Lieferkettengesetz definiert klare Anforderungen an die unternehmerischen Sorgfaltspflichten. Dies schafft eine rechtliche Grundlage, die Unternehmen dazu verpflichtet menschenrechtliche Risiken zu identifizieren, zu bewerten und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Dies soll nicht nur die Rechtssicherheit für Unternehmen erhöhen, sondern auch den Schutz potenziell betroffener Personen gewährleisten.
Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen
Ein weiterer zentraler Aspekt des Lieferkettengesetzes besteht darin, gerechte Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland zu schaffen. Das Ziel: Organisationen, die bereits verantwortungsvoll handeln, sollen nicht im Vergleich zu solchen benachteiligt werden, die Menschenrechts- und Umweltstandards vernachlässigen.
Externe Überprüfung und Durchsetzung
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) überwacht die Einhaltung des Gesetzes, indem es Unternehmensberichte prüft und Beschwerden von Betroffenen nachgeht. Zudem kann das BAFA bei Nichteinhaltung Bußgelder verhängen und Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungen ausschließen. Dies soll sicherstellen, dass Unternehmen ihre Verpflichtungen ernst nehmen und die vorgeschriebenen Standards einhalten.
Das europäische Lieferkettengesetz
Trotz erheblichen Widerstandes, insbesondere seitens Teilen der Bundesregierung, einigten sich die EU-Staaten am 15. März 2024 auf eine EU-weite Richtlinie zum Lieferkettengesetz (Corporate Sustainability Due Diligence Directive; kurz: CSDDD oder CS3D).
Sobald die Erlassung der Richtlinie für ein europäisches Lieferkettengesetz erfolgt, sind die Regierungen der jeweiligen Länder dazu angehalten, diese in nationales Recht umzusetzen. Bereits existierende Lieferkettengesetze, wie das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder das französische Loi de vigilance, müssen dann entsprechend inhaltlich an die Richtlinie angepasst werden.
Das deutsche und europäische Lieferkettengesetz im Vergleich
Sowohl das LkSG als das europäische Lieferkettengesetz zielen grundsätzlich darauf ab, dass Menschenrechte und Umweltstandards in der Wirtschaft eingehalten und globale Lieferketten transparenter dargestellt werden. Es bestehen jedoch wesentliche Unterschiede in Bezug auf Geltungsbereich, Verantwortungsbereich, Umfang und mögliche Konsequenzen für die verpflichteten Unternehmen:
| Das deutsche Lieferkettengesetz | Das europäische Lieferkettengesetz |
|---|---|
| Geltungsbereich: Ab 2023 zunächst für Unternehmen mit 3.000 Beschäftigten; seit dem 1. Januar 2024 für Unternehmen mit 1.000 Beschäftigten. | Geltungsbereich: Das Gesetz gilt für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 450 Mio. Euro. Die Richtlinie gilt auch für Nicht-EU-Unternehmen mit einem entsprechenden Umsatz in der EU. |
| Verantwortungsbereich: Unternehmen müssen Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und gegenüber unmittelbaren Zulieferern verankern. Zudem müssen sie ein Beschwerdeverfahren einrichten, das es ermöglicht, auf Risiken und Verletzungen von Menschenrechten oder Umweltstandards durch mittelbare Zulieferer hinzuweisen und das Risikomanagement entsprechend anzupassen. Bei konkreten Anhaltspunkten für einen Verstoß müssen Unternehmen unverzüglich eine Risikoanalyse durchführen, Präventionsmaßnahmen ergreifen und regelmäßig Berichte über die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten erstellen, wobei die Dokumentation für sieben Jahre aufzubewahren und öffentlich zugänglich zu machen ist. | Verantwortungsbereich: Unternehmen müssen Risikoanalysen durchführen und fortlaufend die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten sicherstellen. Die Regelung betrifft unmittelbare und mittelbare Zulieferer entlang der gesamten Lieferkette. |
| Umfang: Der Schutz der Umwelt ist im Gesetz erfasst, sobald Umweltrisiken zu Menschenrechtsverletzungen führen und wird zusätzlich über zwei internationale Abkommen zum Schutz vor den Gesundheits- und Umweltgefahren durch Quecksilber und langlebige organische Schadstoffe abgedeckt. | Umfang: Das Gesetz bezieht sich auf ökologische und soziale Bereiche, einschließlich fairer Löhne, sicherer Arbeitsbedingungen, Kinderrechte und das Verbot von Zwangsarbeit, moderner Sklaverei und Umweltzerstörung mit Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen für die Nahrungsmittelproduktion, den Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Vermeidung der Abholzung von Wäldern. |
| Mögliche Konsequenzen: Bußgelder, die sich auf bis zu 800.000 Euro oder bis zu zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens belaufen und bis zu drei Jahre Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. | Mögliche Konsequenzen: Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu fünf Prozent des weltweiten Jahresumsatzes und eine zivilrechtliche Haftung bei Fahrlässigkeit oder Vorsatz. |
Neue Lieferkettengesetze: Historie, Status Quo & Ausblick
Im Juni 2021 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“. Bei den Bemühungen um eine EU-weite Lieferkettenrichtlinie leisteten die FDP-geführten Ministerien der Bundesregierung jedoch bis zuletzt erheblichen Widerstand. Am 15. März 2024 einigten sich die EU-Länder dennoch auf ein EU-weites Gesetz – in deutlich abgeschwächter Form. Anders als ursprüngliche formuliert gilt das Gesetz für Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten (anstelle von 500) und einem Jahresumsatz von 450 Mio. (statt 150 Mio.). Auch die zivilrechtliche Haftung wurde abgeschwächt.
Gründung der „Initiative
Lieferkettengesetz“
bestehend aus 63 Organisationen aus
den Bereichen Menschenrechte,
Umwelt, Kirche und Entwicklung.
Monitoring der Bundesregierung
Deutsche Unternehmen fallen bei einem Monitoring der Bundesregierung durch. Nur 20 Prozent erfüllen
menschenrechtliche Vorgaben freiwillig.
Forderungen nach einem
deutschen Lieferkettengesetz
Sowohl aus dem gesellschaftlichen als auch politischen Bereich.
Ankündigung Entwurf EU-Lieferkettengesetz
EU-Kommissar Reynders kündigt den Entwurf eines EU-Lieferkettengesetz für 2021 an.
Einigung im Bundestag
Der Bundestag einigt sich auf ein deutsches Lieferkettengesetz.
Verabschiedung des LkSG
Der Bundestag verabschiedet mit großer Mehrheit das deutsche Lieferkettengesetz.
Vorschlag der Europäischen Kommission
Ein Vorschlag eines
europäischen Lieferkettengesetzes wird vorgestellt.
Inkrafttreten
Seit 1. Januar 2023 ist das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft.
Vorläufige Einigung in der EU
Am 14. Dezember erzielten der Rat und das Europäische Parlament eine vorläufige Einigung zur Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
FDP kündigt an der EU-Richtlinie nicht zuzustimmen
FDP-geführte Ministerien in der Bundesregierung kündigen kurz vor der Abstimmung an, dem Vorhaben nicht zuzustimmen. Im Rat der Europäischen Union hätte dies eine Enthaltung Deutschlands zur Folge, die im Ergebnis wie eine „Nein“-Stimme wirkt.
Abstimmung vertagt
Der Rat der EU-Mitgliedsstaaten verschiebt die Abstimmung zum europäischen Lieferkettengesetz (CS3D) kurzfristig. Hintergrund ist die angekündigte Enthaltung Deutschlands.
EU-Staaten stimmen für ein EU-Lieferkettengesetz
Die EU-Länder verabschieden ein gemeinsames Lieferkettengesetz in abgeschwächter Form.
Pro und Contra eines europäischen Lieferkettengesetzes für Unternehmen
Trotz der Blockade durch die FDP konnten sich die EU-Länder auf ein europäisches Lieferkettengesetz einigen. Welche Vor- und Nachteile hat dies für Unternehmen in Deutschland? Ein Überblick.
Chancen eines europäischen Lieferkettengesetzes für Unternehmen
Ein europäisches Lieferkettengesetz schafft einen einheitlichen rechtlichen Rahmen, um Transparenz und Rechtssicherheit in Europa zu fördern. Diese Harmonisierung beseitigt die Unsicherheiten und Komplexitäten, die mit der Vielfalt nationaler Gesetze einhergehen. Zudem stellt ein europäisches Gesetz sicher, dass EU-weit gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen und deutsche Unternehmen nicht benachteiligt werden. Dies ist besonders vor dem Hintergrund relevant, dass deutsche Unternehmen aufgrund des LkSGs bereits erhebliche Investitionen in die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards getätigt haben.
Ein europäisches Lieferkettengesetz erhöht zudem die Gestaltungsmacht und den Einfluss auf die Einhaltung von Standards in herausfordernden politischen Umfeldern entlang der Lieferkette. Zudem stärkt eine gesetzliche Sicherstellung von Nachhaltigkeitsstandards langfristig auch das Vertrauen von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Produkte und Marken.
Risiken eines europäischen Lieferkettengesetzes für Unternehmen
Gleichzeitig ist es jedoch für global agierende Unternehmen mit stark fragmentierten Lieferketten eine enorme Herausforderung, Mängel entlang ihrer gesamten Lieferkette zu identifizieren. Einige Unternehmen befürchten, dass sie durch ein europäisches Gesetz im internationalen Wettbewerb benachteiligt werden könnten – insbesondere gegenüber Unternehmen aus Ländern ohne vergleichbare Gesetzgebung.
Denn ein europäisches Gesetz wird auch zusätzlichen Kosten und Verwaltungsaufwand für Unternehmen bedeuten, da die Anforderungen über die bestehende deutsche Gesetzgebung hinausgehen. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich unklarer Rechtsbegriffe und der Möglichkeit von zivilrechtlichen Klagen. Mittlere Unternehmen könnten besonders unter den Anforderungen eines europäischen Lieferkettengesetzes leiden, da sie möglicherweise nicht über die Ressourcen verfügen, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Um der unternehmerischen Sorgfaltspflicht nach dem deutschen Lieferkettengesetz gerecht zu werden, sowie sich auf die kommende EU-Richtlinie vorzubereiten, benötigen Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen entlang der Lieferkette. WifOR denkt die Anforderungen auf EU-Ebene bereits jetzt mit, sodass Unternehmen bei in Kraft treten der CS3D auf den jetzigen Lösungen aufbauen können.
Wie kann WifOR Unternehmen im Umgang mit dem Lieferkettengesetz unterstützen?
Wesentliche Bestandteile beider Lieferkettengesetze sind die Risikoanalyse und Priorisierung, um gezielte Präventions- und Abhilfemaßnahmen definieren zu können. Anhand eines makroökonomischen Modells kann WifOR auf Basis von Einkaufsdaten im Rahmen einer Impact Analyse soziale und ökologische Hotspots entlang globaler Lieferketten ermitteln.
Priorisierung mithilfe von Impact Valuation
Bei den Ergebnissen der Impact Analyse handelt es sich zunächst um physische Größen, wie etwa die Anzahl der Arbeitsunfälle oder die ausgestoßenen Tonnen CO₂. Um einen Vergleich – und damit die im LkSG geforderte Priorisierung der Auswirkungen – zu ermöglichen, erfolgt im zweiten Schritt eine Bewertung der Auswirkungen für Umwelt und Gesellschaft in monetären Einheiten.
Mithilfe von Koeffizienten, den sogenannten Impact Valuation-Faktoren, können die gesellschaftlichen Folgeschäden von Arbeitsunfällen und Treibhausgasen in Euro angegeben werden. Diese methodische Herangehensweise ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Auswirkungen von verschiedenen sozialen und ökologischen Indikatoren. So entsteht ein Ranking der Bereiche mit den größten gesellschaftlichen Auswirkungen, welches als datenbasierte Grundlage für die Priorisierung von Maßnahmen dient.
Eigene Berechnungen mit dem WifOR Sustainability Impact Tool (WISIT)
Für Unternehmen, die die Risikoanalyse und Priorisierung selbst vornehmen möchten, bietet WifOR WISIT. Das WifOR Sustainability Impact Tool beinhaltet ein LkSG-Feature, das Unternehmen bei der Analyse und Berichterstattung unterstützt. Es ermöglicht, Risiken entlang der Lieferkette zu identifizieren, zu analysieren und zu priorisieren. Die Ergebnisse werden in einem Format bereitgestellt, das sich direkt in die finalen LkSG-Berichtsdokumente übertragen lässt.
Im Video erfahren Sie, wie Unternehmen mithilfe von WISIT den LkSG-Anforderungen gerecht werden können: